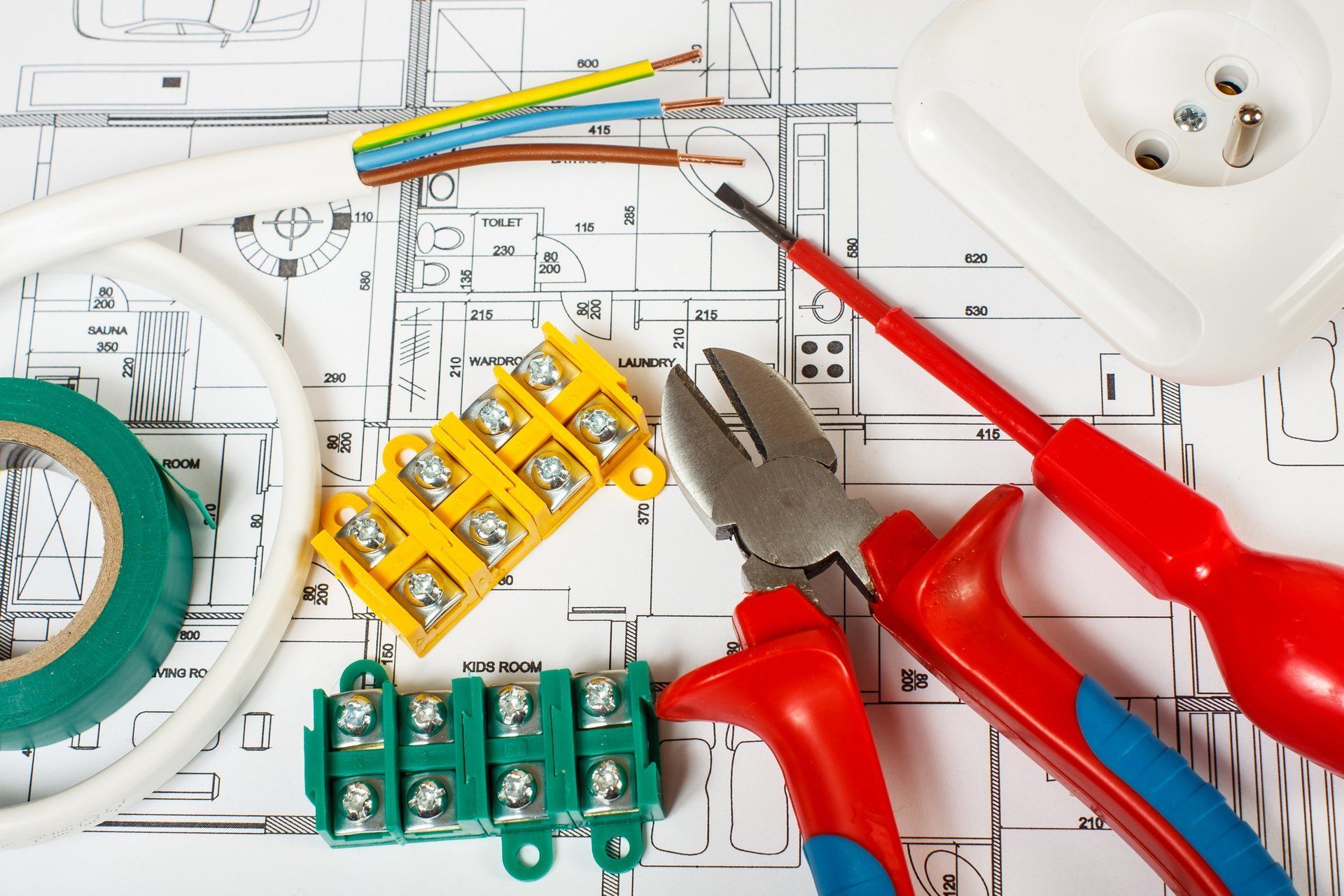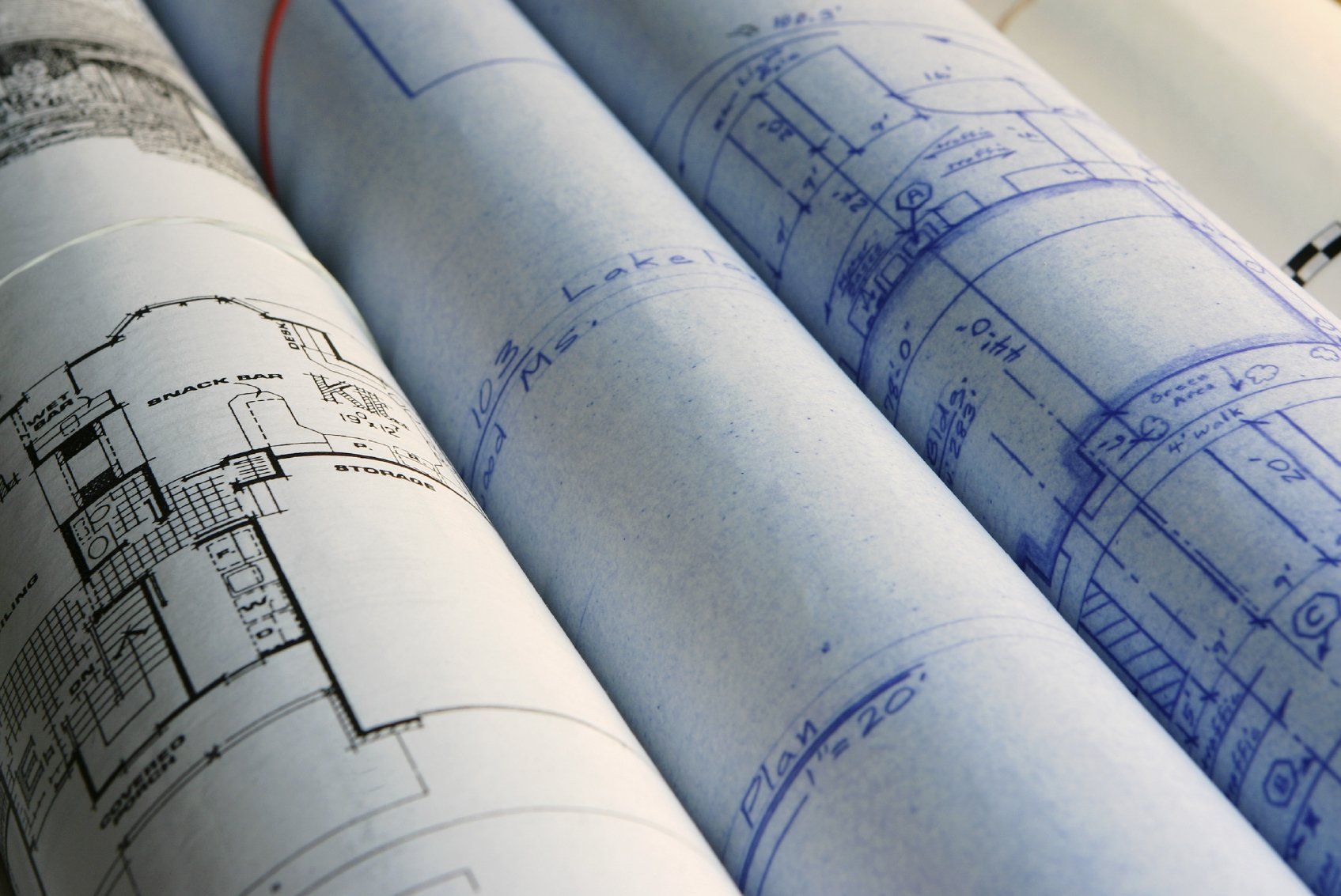Die Wirkungen der „Schonfristzahlung“
Árpád Farkas, Anwalt für Immobilienrecht
Nicht neu, aber von manchen Gerichten unerwünscht: Ein innerhalb der Schonfrist des § 569 (3) 2 S. 1 BGB erfolgter Ausgleich des Mietrückstands hat lediglich Folgen auf die ausgesprochene fristlose, nicht jedoch Folgen für eine aufgrund desselben Mietrückstands ergangene ordentliche Kündigung (BGH, Urteil vom 23.10.2024 – VIII ZR 177/23).
Es ist keine neue Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, sondern die Fortsetzung seiner ständigen Rechtsprechung, wenn das höchste deutsche Zivilgericht in Wohnraummietsachen ausdrücklich erklärt, dass für den Fall, dass ein Mieter mit zwei Mieten in Zahlungsrückstand ist und der Vermieter aufgrund dieses Zahlungsrückstands zunächst eine außerordentlich fristlose sowie gleichzeitig eine hilfsweise ordentlich fristgerechte Kündigung ausspricht, der Ausgleich des Mietrückstands durch den Mieter selbst oder in Form einer entsprechenden Verpflichtung einer öffentlich-rechtlichen Stelle (z. B. Jobcenter) sich lediglich auf die fristlose Kündigung bezieht und diese heilt. Die ordentliche Kündigung bleibt im Raum und ist weiter geeignet, das Mietverhältnis zu beenden.
Das Landgericht Berlin, dort vor allen Dingen die 66. Zivilkammer, weigert sich seit Jahren vehement, diese Grundsätze anzunehmen und anzuwenden. So auch in einer Entscheidung vom 14.06.2023, in der sie eine Räumungsklage des Vermieters abwies.
Der Fall:
Die beklagte Mieterin war seit August 2006 in einer Wohnung der Klägerin in Berlin beheimatet. Nachdem die Mieterin für die Monate Januar und Februar 2022 die geschuldete Miete nicht gezahlt hatte, erklärte die Vermieterin mit Schreiben vom 14.03.2022 die fristlose und gleichzeitig hilfsweise die ordentliche Kündigung des Mietverhältnisses wegen Zahlungsverzugs. Am 17.03.2022, also drei Tage nach Zugang der Kündigung, glich die Mieterin den Mietrückstand vollständig aus.
Während das Amtsgericht in Berlin die BGH-Rechtsprechung kennt und verinnerlicht hat, demzufolge der Räumungsklage stattgab, führte die Berufung der Mieterin dazu, dass die 66. Kammer des Landgerichts Berlin die Räumungsklage zurückwies.
Die Entscheidung:
Zu Unrecht, wie der Bundesgerichtshof nun bereits mehrfach feststellen musste.
Der Bundesgerichtshof weist ausdrücklich nochmals darauf hin, dass die rechtzeitige sogenannte „Schonfristzahlung“ nach § 569 (3) 2 BGB lediglich die außerordentliche Kündigung heilt. Eine vom Vermieter aufgrund desselben Zahlungsrückstands zugleich ausgesprochene („hilfsweise“ erklärte) ordentliche Kündigung wird von der Schonfristzahlung nicht geheilt. Das bedeutet im Ergebnis, dass der Mieter durch einen Ausgleich der Mietrückstände zwar die außerordentlich fristlose Kündigung aus der Welt schaffen kann, die ordentliche Kündigung jedoch in der Welt bleibt und der Mieter, soweit nicht Härtefallgründe vorliegen, zur Räumung der Wohnung nach Ablauf der Kündigungsfrist verurteilt wird.
Tipps für die Praxis:
Der Bundesgerichtshof macht nochmals klar, dass zunächst immer darauf zu achten ist, dass bei Erklärung einer außerordentlich fristlosen Kündigung wegen Zahlungsverzugs gleichzeitig auch hilfsweise eine ordentliche Kündigung erklärt wird. Für den Fall, dass der Mieter oder das Jobcenter die Miete nachzahlt, bleibt dann zumindest die ordentliche Kündigung im Raum und kann im Rahmen einer Räumungsklage weiterverfolgt werden. Weiterhin zeigt die BGH-Rechtsprechung aber auch, dass nicht jedes Gericht von dieser Regelung des Gesetzes angetan ist und auch nicht jedes Gericht die Rechtsprechung des BGH kennt. Umso besser ist es daher, sich bei Ausspruch der Kündigung von einem versierten Fachmann, z.B. einem Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht unterstützen zu lassen.