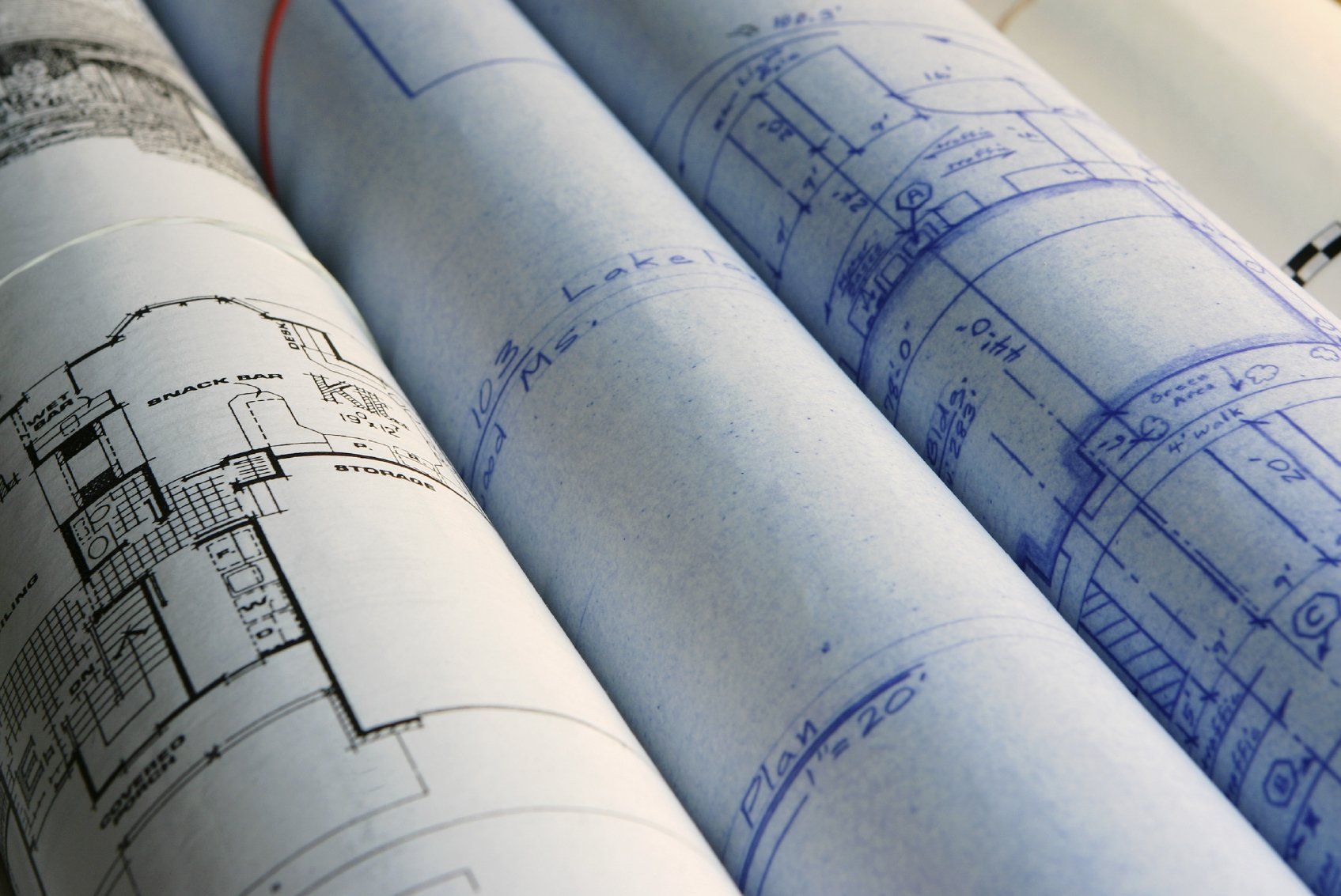Der verpachtende Wohnungseigentümer als Störer
Árpád Farkas, Anwalt für Immobilienrecht
Einen komplizierten Fall hatte der Bundesgerichthof mit Urteil vom 21.03.2025 – V ZR 1/24 – zu entscheiden. Hierbei ging es um eine Konstellation, in der der Pächter eines Wohnungseigentümers unerlaubt bauliche Veränderungen des gemeinschaftlichen Eigentums vorgenommen hatte und die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer Beseitigungsklage gegen den vermietenden Wohnungseigentümer erhoben hatte. Der vermietende Wohnungseigentümer wusste von den unerlaubten Baumaßnahmen, schritt aber gegenüber dem Mieter nicht ein.
Der Fall:
Der Beklagte war Teileigentümer einer Gewerbeeinheit und Mitglied der klagenden Gemeinschaft der Wohnungseigentümer (GdWE). Er verpachtete seine Gewerbeeinheit als Shisha Bar. Der Pächter ließ zwecks Installation einer Lüftungsanlage und Verlegung von Kabeln und einer Abwasserleitung die Deckenplatte zwischen der Gewerbeeinheit und dem Keller sowie mehrfach – teils in einem Durchmesser von 80 bis 100 cm – die Fassade durchbohren.
Die Hausverwaltung forderte den Beklagten mehrfach vergeblich auf, sämtliche Arbeiten einzustellen bzw. auf den Pächter einzuwirken, dass dieser die Arbeiten einstellt. Nachdem die Aufforderungen nicht fruchteten, beschloss die GdWE, den Beklagten unter anderem im einstweiligen Verfügungsverfahren auf Beseitigung der baulichen Veränderungen in Anspruch zu nehmen. Der Beklagte wiederum beantragte Gestattung der baulichen Veränderungen, allerdings erst in einem später separaten gerichtlichen Verfahren.
Der BGH hatte nunmehr über das Schicksal der Beseitigungsklage der GdWE gegen den beklagten Teileigentümer zu entscheiden. Das Amts- und das Landgericht hatten jeweils der Beseitigungsklage der GdWE stattgegeben.
Auch der BGH ließ die Beseitigungsklage erfolgreich enden.
Die Gründe:
Beschlusszwang bei Baumaßnahmen
Der Bundesgerichtshof hatte bereits in einem anderen Verfahren zu von der Wohnungseigentümergemeinschaft geltend gemachten Unterlassungsansprüchen entschieden, dass der Wohnungseigentümer, der eine bauliche Veränderung ohne erforderlichen Gestattungsbeschluss nach § 20 (1) WEG vornimmt, der klagenden GdWE nicht entgegenhalten kann, dass ein Gestattungsanspruch besteht (vgl. BGH, Urteil vom 17.03.2023 – V ZR 140/22). Dies überträgt der Bundesgerichtshof im vorliegenden Fall nunmehr auch auf Beseitigungsklagen. Auch hier hat der Bundesgerichtshof jetzt entschieden, dass, selbst wenn dem Wohnungseigentümer ein Anspruch auf Gestattung gegen die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer nach § 20 (3) WEG gerichtet auf die bauliche Veränderung zusteht, dieser Anspruch nicht als Einrede gegen die Beseitigungsklage erhoben werden kann.
Obwohl der BGH vorliegend unterstellen musste, dass dem Beklagten ein Anspruch gegen die GdWE auf Erstattung der baulichen Veränderung zustand, konnte dies dem beklagten Teileigentümer im vorliegenden Verfahren nicht helfen. Dies rührt daher, dass sich der Gesetzgeber durch die Neufassung von § 20 (1) WEG bewusst für den sogenannten „Beschlusszwang“ entschieden hat, um Auslegungsschwierigkeiten zu vermeiden und die vielfältigen Zweifelsfragen im Zusammenhang mit baulichen Veränderungen zu beseitigen. Danach ist von jedem einzelnen Wohnungseigentümer, der bauliche Veränderungen beabsichtigt, ein legitimierender Beschluss der GdWE zu fordern, selbst dann, wenn kein Wohnungseigentümer in rechtlich relevanter Weise beeinträchtigt wird. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die Wohnungseigentümer über alle baulichen Veränderungen des Gemeinschaftseigentums informiert werden. Für den bauwilligen Wohnungseigentümer hat der legitimierende Beschluss den Vorteil, dass er – ebenso wie eventuelle Rechtsnachfolger – durch dessen Bestandskraft Rechtssicherheit erlangt. Außerdem gab der BGH zu bedenken, dass es nicht angehen kann, die übrigen Wohnungseigentümer in die Rolle zu drängen, auf die Erhebung einer Klage durch die GdWE hinwirken zu müssen, damit ein Unterlassungs-/ Beseitigungsanspruch geltend gemacht wird. Vielmehr muss es umgekehrt so sein, dass der Wohnungseigentümer immer gehalten sein muss, einen entsprechenden Gestattungsbeschluss zu erlangen.
Widerklage als Rettungsanker für den Eigentümer
Interessant war in diesem Zusammenhang, dass sowohl das vorbefasste Landgericht als auch der Bundesgerichtshof in diesem Zusammenhang klar erläuterten, dass der auf Beseitigung oder Unterlassung in Anspruch genommene Wohnungseigentümer im Rahmen einer Widerklage seinen Gestattungsanspruch in dem Gerichtsverfahren geltend machen muss, in dem er auf Unterlassung / Beseitigung in Anspruch genommen wird. Für eine solche Widerklage bedarf keiner Vorbefassung der Eigentümer. Die Verfolgung des Gestattungsanspruchs im Wege einer solchen Widerklage ist prozessökonomisch und führt dazu, dass alle im Zusammenhang mit der einen Gestattungsbeschluss erfordernden und ansonsten rechtswidrigen baulichen Veränderung zwischen den Parteien streitigen Fragen zeitnah in einem Verfahren geklärt werden. Das Gebot der Vorbefassung steht der Widerklage regelmäßig nicht entgegen, denn durch die gerichtliche Geltendmachung des Beseitigungsanspruchs wird der der baulichen Veränderung entgegenstehende Mehrheitswillen hinreichend deutlich und die Befassung der Versammlung wäre eine unnötige Förmelei.
Vermieter/Verpächter kann Störer sein
Weiterhin stellte der Bundesgerichtshof klar, dass den verpachtenden/vermietenden Wohnungseigentümer eine Haftung gegenüber der GdWE als mittelbarer Handlungsstörer trifft, wenn in wertender Betrachtung und unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls er eine Störung durch einen anderen in adäquater Art und Weise durch seine Willensbetätigung kausal mit verursacht und es dem Eigentümer möglich und zumutbar war, die Störung zu verhindern. Dem Eigentümer ist die Verantwortung für Störungshandlungen seines Pächters/Mieters zu übertragen, wenn er diesem den Gebrauch seiner Sache mit der Erlaubnis zu störenden Handlungen überlassen hat oder aber es unterlässt, ihn von seinem fremden Eigentum beeinträchtigenden Gebrauch abzuhalten. Einen vermietenden Wohnungseigentümer trifft dementsprechend eine Haftung als mittelbarer Handlungsstörer für vom Pächter/Mieter ohne erforderlichen Gestattungsbeschluss vorgenommene bauliche Veränderung des gemeinschaftlichen Eigentums. Voraussetzung hierfür ist, dass er die baulichen Veränderungen erlaubt hat oder dass er mit baulichen Veränderungen wegen einer von dem Mieter angekündigten Nutzungsabsicht rechnen muss und den Mieter gleichwohl nicht auf das Erfordernis eines vorherigen Gestattungsbeschlusses hinweist oder dass er es unterlässt, gegen den Mieter einzuschreiten, nachdem er Kenntnis von der Vornahme der baulichen Veränderungen erlangt hat.
Folgen für die Praxis:
Kein Bauen ohne Beschluss!
Der Bundesgerichtshof erläutert erneut, dass Beschlusszwang nach § 20 (1) WEG für sämtliche bauliche Veränderungen im Gemeinschaftseigentum gilt. Der Gesetzgeber hat sich hierfür mit guten Gründen entschieden.
Kommt es zu nicht gestatteten baulichen Veränderungen im Gemeinschaftseigentum, kann die GdWE sowohl Unterlassungs- als auch Beseitigungsansprüche erfolgreich geltend machen. Der Eigentümer kann diesen Ansprüchen nicht entgegenhalten, dass „nur“ sein Mieter die unzulässigen baulichen Veränderungen vorgenommen hat, wenn er zum Beispiel durch eine Unterlassungsaufforderung der Verwaltung Kenntnis von den Baumaßnahmen erlangt hat.
Widerklage kann helfen
Ist ein verklagter Wohnungseigentümer der Auffassung, ihm seien die baulichen Veränderungen zu gestatten, so hat er spätestens im Klageverfahren gerichtet auf die Beseitigung oder Unterlassung der baulichen Veränderung Widerklage zu erheben.